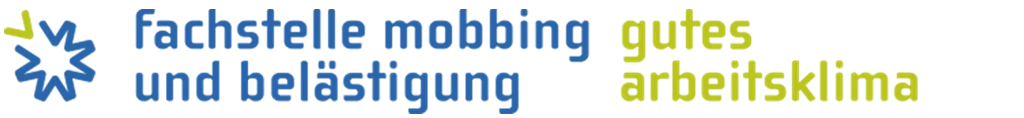Ob in Besprechungen, beim informellen Austausch oder in heiklen Situationen: Immer wieder erleben Menschen am Arbeitsplatz, dass ihre Grenzen übertreten werden. Sei dies verbal, körperlich oder emotional. Viele spüren den Impuls, sich zu wehren, verstummen aber aus Unsicherheit oder Angst vor Konflikten. Dabei ist das Benennen der eigenen Grenzen ein wesentlicher Bestandteil persönlicher Integrität und psychischer Selbstfürsorge.
Doch wie gelingt es, die eigenen Grenzen so zu kommunizieren, so dass sie gehört und respektiert werden?
Persönliche Grenzen verstehen
Grenzen markieren, was für uns in Ordnung ist und was nicht. Sie können ganz unterschiedlich gelagert sein:
- Physische Grenzen: z. B. Berührungen oder Nähe
- Emotionale Grenzen: z. B. persönliche Fragen oder abwertende Bemerkungen
- Leistungsbezogene Grenzen: z. B. ständige Erreichbarkeit oder unrealistische Erwartungen
- Wertbezogene Grenzen: z. B. sexistische, rassistische oder respektlose Aussagen
Jeder Mensch hat ein anderes Empfinden dafür, wann eine Grenze erreicht ist. Deshalb ist es wichtig, dass wir nicht auf allgemeine Massstäbe warten, sondern lernen, unsere eigenen, ganz persönlichen Grenzen zu erkennen und klar zu benennen.
Zwischen Unsicherheit und Harmoniebedürfnis: Warum wir unsere Grenzen oft nicht aussprechen
Viele von uns haben gelernt, angepasst zu reagieren, freundlich zu bleiben, „nichts draus zu machen“. Gerade in hierarchischen Arbeitsverhältnissen spielen ausserdem Machtverhältnisse und Unsicherheiten eine grosse Rolle.
Typische innere Hürden sind:
- „Ich will nicht überempfindlich wirken.“
- „Ich möchte kein schlechtes Arbeitsklima verursachen.“
- „Ich weiss gar nicht genau, was mich stört, es gibt mir einfach ein ungutes Gefühl.“
Diese Gefühle sind ernst zu nehmen. Doch sie dürfen uns nicht daran hindern, uns zu schützen. Denn dauerhaft übergangene Grenzen führen oft zu Frustration, innerem Rückzug oder sogar Krankheit.
Grenzen klar und respektvoll kommunizieren: So gelingt es
- Wahrnehmung schärfen: Bevor du kommunizierst, musst du wissen, wo deine Grenze liegt. Achte auf Körpersignale: Beklemmung, Wut, Enge im Hals.
- In der Ich-Perspektive sprechen: „Ich fühle mich unwohl, wenn …“ statt „Du übertreibst mal wieder …“. So bleibt die Verantwortung für das Gesagte bei dir, und du vermeidest Schuldzuweisungen.
- Klarheit statt Entschuldigungen: „Bitte unterlasse solche Bemerkungen.“ ist stärker als „Ich weiss, das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber …“
- Körpersprache einsetzen: Ein ruhiger Ton, fester Blickkontakt und eine aufrechte Haltung unterstützen deine Botschaft.
- Konsequenzen ankündigen: „Wenn das nochmal vorkommt, werde ich mich an unsere Ansprechstelle wenden.“ Dieser Schritt ist besonders bei wiederholten Grenzverletzungen wichtig und legitim.
Grenzen kommunizieren heisst nicht beziehungsfeindlich sein
Im Gegenteil: Klare Kommunikation schafft Orientierung. Sie zeigt deinem Gegenüber, wie ein respektvoller Umgang mit dir möglich ist und lädt auch andere ein, ihre Grenzen mitzuteilen. Das stärkt Beziehungen, statt sie zu gefährden.
Die klare Kommunikation der Grenzen ist somit kein Egoismus, sondern ein Beitrag zu einer gesunden Arbeitskultur.
Fazit
Du musst nichts aushalten, was sich nicht gut anfühlt. Deine persönliche Grenze ist valide – auch wenn andere sie (noch) nicht nachvollziehen können. Sie zu erkennen und zu benennen, ist ein Ausdruck von Selbstachtung und ein zentraler Schritt, um Integritätsverletzungen vorzubeugen.
Denn nur wer sich selbst schützt, kann auch für andere eintreten.